Von entscheidungsfaulen Frauen, einer Taxiodysee und drogenfahndenden Polizisten-Groupies
- Restlesstraveller

- 14. Sept. 2019
- 15 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 23. Nov. 2019
Wir sind noch keine Woche in Kolumbien und haben bereits genug erlebt, um daraus eine solch spannende Geschichte zu spinnen, wie sie wahrscheinlich die wenigsten Backpacker aus Kolumbien können. Aber von vorne. Der 0-8-15 Backpacker macht die Tour von Medellin, Bogota nach oben bis Cartagena. Da geht’s dann weiter nach Santa Marta, von wo aus man die beliebten Touren: Minca, Tayrona Park und je nach dem Cabo de la Vela buchen kann. Genau solch eine 0-8-15 Tour hatten auch ich und Helen im Sinn, bloss entschieden wir uns wegen der knappen, uns zur Verfügung stehenden Zeit von «nur» 3 Wochen für die schneidigere Version. Wir würden uns dem Wetter zuliebe bloss auf die Karibikküste konzentrieren. Also flogen wir nach Cartagena und wollten von da gleich nach Santa Marta aufbrechen, um all die tollen Backpacker-Dinge zu machen, die Backpacker auf ihrer Kolumbienreise eben so tun.
Doch das Schicksal machte uns einen Strich durch die Rechnung. Obwohl es anfangs so aussah, als ob es sich mit Helen anlegen und ihr eine Lektion zum Thema Gepäck erteilen wollte, weiss ich heute, dass es bloss Mittel zum Zweck war, um uns auf den Pfad der Erleuchtung zu bringen. Nun, erleuchtet wurde von uns beiden eigentlich bloss Helen. Ich war im Lehrer-Planer-Modus und wollte unseren ursprünglich geschmiedeten Plan eisern verfolgen, und wenn nötig mit aller Härte durchsetzen. Die entscheidungsfaule Helen und ihr fehlender Rucksack machten mir die Sache allerdings ganz schön schwer, denn: wir steckten in Cartagena fest. Ohne Gepäck weiter zu reisen machte keinen Sinn, also mussten wir warten. Und das, obwohl unsere Zeit beschränkt und jeder einzelne Tag deshalb ungeheuer kostbar war. Ein Desaster! Wir beide waren uns schnell einig, dass wir Cartagena so schnell als möglich verlassen wollten. Nicht, dass ihr das falsch versteht, das ehemalige Kolonial(alt)städtchen ist echt süss. Aber leider ist hier bereits das eingetroffen, wovor ich mich gefürchtet habe: die Stadt geht am Tourismus kaputt. Überall wird man von den Einheimischen mit Massagen oder Hüten bedrängt, die man kaufen soll. Allerhand wird einem angedreht: Touren, Restaurants, Dienstleistungen, Krims Krams und sonstiges unnützes Zeugs. Und dabei bleiben die Anwohner leider alles andere als distanziert. Sie kennen keine Grenzen, fassen einen an und folgen einem auf der Strasse, während sie dich zutexten, so schnell, dass du es nicht mal verstehen könntest, selbst wenn du es wolltest. Leider wird das mit der Zeit so lästig, dass wir nur noch weg wollten. Ein ganz dreistes Manöver begegnete mir am Strand: eine Frau kam mit Eimer zu mir und hielt ihren Arm neben den Meinen, augenscheinlich um die Hautfarbe zu vergleichen. Wie weiss ich sei meinte sie noch, als sie plötzlich meinen Arm packte und wie in einem Schraubstock festhielt, während sie mit der anderen Hand in ihren den Eimer griff. Ich konnte eine klare Flüssigkeit (Wasser?), einen Seifenspender und einen Schwamm erkennen. Wütend entriss ich ihr meinen Arm. Ich nehme an, sie wollte ihn waschen. Das ist mir danach nicht mehr passiert, aber die aufdringlichen Männer und Frauen begegneten uns leider immer wieder.
Also war klar: Sobald wir Helens verschollenes Gepäck erhielten, wollten wir weg. Doch wohin? Ich hielt an unserem ursprünglichen Plan fest, den wir aber noch nicht organisiert hatten: eine Nacht im (wie wir später herausfinden mussten sehr berühmten und begehrten) Wasserhostel Casa en el agua. Der Typ im Hostel versuchte uns noch verzweifelt eine Tour auf einer der anderen Inseln vor Cartagena zu verkaufen, doch wir weigerten uns inständig. Doch die Frage blieb: Wie zum Teufel kamen wir zu diesem Wasserhostel, welches per Boot zwei bis drei Stunden entfernt im Bernardo-Archipel lag, mitten im Ozean? Die Frage erledigte sich von selbst, als ich reservieren wollte: das Hostel war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Ein neuer Plan musste her, doch bei Helen und mir war irgendwie der Wurm drin. Wir diskutierten endlos und waren hin und hergerissen zwischen einer weiteren Nacht in Cartagena oder einem Ausflug auf eine der Inseln vor Cartagena. Unsere Meinungen gingen auseinander, und eine Minute wollte jemand von uns das eine, nur um in der nächsten Minute etwas anderes zu wollen. Wir konnten uns für nichts mehr begeistern, waren lustlos und noch weniger waren wir bereit, uns für etwas zu entscheiden. Und so plätscherten die Stunden dahin, ohne dass wir wussten, wie es am nächsten Tag für uns weitergehen würde. Wir schoben das Problem bis zum Abendessen vor uns her, als wir uns endlich an einen Tisch setzten und die Lage besprachen. Während ich versuchte, zwischen den bis anhin erwähnten Optionen zu entscheiden, war Helen bei ihrer Recherche im Internet auf etwas Neues gestossen: Rincon del Mar. Ich hatte noch nie davon gehört, geschweige denn davon gelesen. Ein ursprüngliches Fischerdorf auf dem Festland, direkt vor den Bernardo-Islands sollte es sein, hoch gepriesen in Reiseblogs und noch weitgehend untouristisch. Damit hatte sie zumindest meine Aufmerksamkeit erlangt. Doch es stellte sich heraus, dass die Anreise schwierig war. Es gab keine direkte Verbindung von Cartagena aus dorthin, bloss einen Bus morgens um 6 Uhr oder abends um 17 Uhr, jedenfalls suggerierte das das Internet. Die Fahrt dauerte drei bis vier Stunden, und würden wir den späteren Bus nehmen, wäre es stockfinster bis wir dort ankämen. Denn bei der Bushaltestelle war noch nicht Endstation, man musste an einem Ort namens San Onofre aussteigen und dort ein MotoTaxi (die Einheimischen nahmen dich auf ihrem Motorrad mit) nehmen, welches einen zum Dorf bringen würde. Mir war die ganze Sache nicht geheuer, und die Zeit drängte. Es war abends, und ich war müde. Ich wollte nichts kompliziertes, nichts anstrengendes, nichts abenteuerliches. Ich wollte einfach unserem Plan folgen. Ich wollte Sicherheit. Morgen mussten wir spätestens um 11 Uhr aus dem Hostel auschecken, und ich wollte wissen, wo wir hin sollten. Wir waren beide mit den Nerven am Ende, müde und gestresst. Aber niemand von uns war bereit, die Fäden in die Hand zu nehmen. Und so verstrichen weitere Stunden. Schlussendlich liess ich mich nach langem Ringen auf ihre neue Idee ein, und wir begannen, nach Hostels in Rincon suchen. Wir fanden eines, welches toll aussah, aber noch keinerlei Bewertungen von anderen Reisenden aufweisen konnte. Es war anscheinend ganz neu, und wir entschieden uns dafür, es zu riskieren und dort anzufragen. Die Lodge bot auch einen Abholdienst an, wenn auch für einen relativ hohen Preis, doch ich konnte Helen dazu überreden, dass wir dieses Angebot annahmen. Wir waren erst einige Tage im Land und ich traute dem öffentlichen Busverkehr in Kolumbien noch nicht, vor allem abends, und empfand es als sicherer, ein privates Taxi bis dorthin zu engagieren. Dafür war ich gern bereit, den Preis zu zahlen. Blieb nur noch das Problem mit ihrem Gepäck, welches erst am nächsten Tag mit dem Flugzeug ankommen würde. Doch auch dafür fanden wir schlussendlich die für uns perfekte Lösung: warum nicht zum Flughafen, das Gepäckstück in Empfang nehmen und uns direkt vom Flughafen vom Taxi abholen und von dort nach Rincon del Mar bringen lassen? Wir priesen uns für unseren Scharfsinn und genauso machten wir es. Wir bestellten das Taxi um fünf an den Flughafen, weil das Flugzeug aus Amsterdam um halb 5 landen und uns das genug Zeit geben sollte, Helens Gepäckstück zu holen und dann mit dem Taxi gen Süden zu fahren. Die freundliche Besitzerin der Lodge Dos Aguas organisierte den Transport für uns und wir hielten Kontakt über Whatsapp. Ich versprach, mich zu melden, sobald wir am Flughafen seien.
Doch unser Plan ging nicht auf: der Flughafen in Cartagena verfügte wider meiner Erwartungen über keinerlei Wifi, und wir hatten die Rechnung ohne die flughafengetreue Verspätung gemacht. Unser Flug landete mit über einer Stunde Verspätung und ich hatte in der ganzen Zeit keinerlei Möglichkeit gehabt, die von Dos Aguas oder unseren Fahrer zu kontaktieren. Nervös tigerte ich den ganzen Flughafen ab, von vorne bis hinten, von oben bis unten, auf der Suche nach unserem Fahrer. Ich betete und hoffte, dass er auf uns wartete, und meine Panik und der Stress stieg mit jeder Minute, die verging und die wir wegen der Verspätung ausharren mussten. Helen war keine Hilfe, weil sie sich in der Zeit Sorgen um ihr Gepäck machte. Als es endlich da war, konnten wir die KLM-Mitarbeiterin dazu bringen, die Nummer von unserem Fahrer von ihrem kolumbianischen Handy aus anzurufen. Sie besprach sich mit ihm und meinte danach zu uns, er sei schon seit einer Stunde hier. Er hätte gerade aufgeben und gehen wollen. Wir bedankten uns bei ihr, packten unsere Sachen und rannten nach draussen. Und da stand er, unser Fahrer Abel, an einem Platz wo ich sicher war, dass er bei meinem Rundgang noch nicht dort gestanden hatte! Obwohl ich erwartet hätte, dass er wütend war wegen der Verspätung, wirkte er ruhig und gelassen. Freundlich sogar. Als wir endlich wohlbehalten im Auto sassen und die lange Fahrt endlich beginnen konnte, war es bereits dunkel. Abel rief die Besitzerin des Dos Aguas an und informierte sie darüber, dass er uns gefunden hatte. Danach hielt er mir das Telefon hin. Sie klang nicht gerade erfreut und etwas vorwurfsvoll als sie meinte, Abel hätte eine Stunde gewartet und gerade gehen wollen weil er nichts gehört hätte. Es sei eine dreistündige Fahrt und sie wolle mich (Abel sprach kein Englisch und wir nicht sehr gut spanisch) informieren, dass Abel auf dem Weg seine Freundin abholen würde und sie uns Gesellschaft leisten würde, damit er danach nicht alleine in der Dunkelheit zurückfahren müsse. Ich fand das etwas befremdlich für einen Taxifahrer, schliesslich war das sein Job und wir mussten extra draufzahlen, weil der Transport nachts geschah, aber ich sagte ihr natürlich, dass das für mich in Ordnung war. Als ich Helen davon erzählte, machte sie sich wahnsinnige Vorwürfe, obwohl das ja niemand hatte voraussehen können, auch wir nicht, dass das Gepäck eine ganze Stunde später ankommen würde. Und ich musste mir selbst immer wieder sagen, dass es sein Job war, Leute von A nach B zu bringen, auch abends. Er wurde sogar sehr gut dafür entlöhnt. Doch Helen konnte nicht aufhören, sich darüber Gedanken und Vorwürfe zu machen. Ich wurde langsam wütend, und bevor ich sie anschrie, schaltete ich auf Durchzug. Ich wollte das nicht mehr hören. Mein Gott, so ein riesen Drama war das ja nicht, ist ja nochmal alles gut gegangen! Ich nahm meine Kopfhörer raus und hörte meine Musik und starrte in die dunkle Nacht hinaus, bevor ich irgendwann erschöpft eindöste.
Ich erwachte durch ein Ruckeln. Es war stockdunkel und die Strasse schlecht, ich nahm im Halbschlaf immer wieder rot blinkende Baustellenlichter wahr. Die ganze Fahrt kostete uns schlussendlich 4 Stunden anstatt drei, wegen all den Baustellen und dem Verkehr. Wir kamen um halb elf Uhr in San Onofre an. Unser Fahrer Abel und seine Freundin hatten wohl genug und auf eigene Faust einen weiteren Fahrer aus San Onofre organisiert, ein Freund von ihm, der uns nach Rincon bringen sollte. Ich war zu müde und zu erschöpft, um mir darüber Sorgen zu machen. Abel wartete mit uns im Auto, bis sein Freund eintraf, und wickelte mit ihm das Geschäft ab. Dann luden sie unsere Sachen ins nächste Auto und er verabschiedete sich von uns. Dania aus unserer Unterkunft sei informiert, versicherte er uns. Als Dank und vor allem wegen dem schlechten Gewissen, das Helen mir eingeredet hatte, schenkte ich ihm meinen Ovo-Aufstrich-Vorrat für Notfälle. Dann stiegen wir ins nächste Auto ein, in dem sein Kumpel mit seiner Frau sass. Auch sie wirkten äusserst freundlich, aber ihr Auto sah aus, als hätten sie es kurz vorher aus der Müllhalde gezogen. Es rostete, Teile der Karosserie fehlten, und während der Fahrt krachte und ächzte das gesamte Fahrzeug. Doch das hinderte unseren neuen Fahrer nicht daran, wie ein Wahnsinniger über die Dreckschotterpisten zu rasen, die zum Fischerdorf führten. Keine offiziellen Strassen mehr, nur noch eine «Dirtroad» durch den Wald, mit Schlaglöchern und Steinen. Wir wurden hinten ganz schön durchgeschüttelt. Nun wach und voller Adrenalin klebte ich an der Fensterscheibe und betrachtete die Bäume, die an uns vorbei rauschten. Immer wieder krachte die Karosserie auf Bodenwellen, und man hörte deutlich, wie da unten etwas kaputt ging. Irgendetwas wurde metallisch blechern am Boden entlanggeschleift. Doch unseren Überschallpiloten schien das nicht zu interessieren, im Gegenteil! Während Helen sich in ihren Sitz krallte und vorsichtshalber den Sicherheitsgurt festschnallte, begann ich zu lachen. Übermüdet, nehme ich an. Aber irgendwie machte mir die ganze Fahrt Spass. Der Fahrer schien die Strasse in und auswendig zu kennen und genau zu wissen, was er tat. Dann tauchte vor uns plötzlich ein Jeep auf. Statt das Tempo zu drosseln, drückte unser Fahrer aufs Gaspedal und setzte zu einem Überholmanöver an. Gerade als mir der Gedanke durch den Kopf schoss, sah ich das Logo, das auf der Seite des Jeeps prangte: Polizia.
Alles ging wahnsinnig schnell. Kaum hatten wir die Polizei überholt, hatte sie sich auch schon an unsere Versen geheftet. Aus dem Nichts tauchten vor uns zwei weitere Polizeiwagen auf, die auf das Blaulicht des Wagen hinter uns hin ihr Tempo verlangsamten und zum Stillstand kamen. Unser Fahrer war gezwungen, anzuhalten. Die Strasse vor und hinter uns war blockiert, es gab kein Durchkommen mehr. Mein Herz pochte. Und plötzlich waren wir umringt von Polizisten in Kampfuniform: Maschinengewehr im Anschlag. Ich hatte sie nicht kommen sehen, aber es waren so viele, dass nicht alle aus den Autos hatten aussteigen können. Die mussten sich in den Wäldern versteckt haben! Mir wurde mulmig zu Mute und ich blickte in Helens erschrockenes Gesicht. Versuchte, eine gelassene Miene aufzusetzen um sie nicht noch mehr zu beunruhigen. Selbst unser Fahrer wirkte etwas verunsichert. Es war mucksmäuschenstill geworden in unserem Taxi, der plärrende kolumbianische Drama-Sänger mit seiner Handorgel aus dem Radio auf stumm geschaltet. Alle warteten wir angespannt, was als nächstes passieren würde. Als erstes wurde ans Fenster unseres Fahrers geklopft. Er liess es herunter und unterhielt sich leise auf Spanisch. Er musste aussteigen. Dann klopfte es an Helens Tür, und kaum hatte sie sie geöffnet, wiesen die drei Polizisten auf meiner Seite mich an, meine Tür ebenfalls zu öffnen. Ich war so voller Adrenalin, dass ich mich nicht fürchtete. Ich empfand die Situation momentan als einschüchternd, aber ich spürte erstaunlicherweise keine Furcht. Schliesslich hatten wir nichts verbrochen. Mir wurde mit einer Handbewegung bedeutet, auszusteigen. Ich musste mich mit dem Rücken gegen das Auto drehen und verlor Helen aus den Augen. Das Ganze war so surreal, dass ich überzeugt war, ich befände mich gerade in einem Film. Vier uniformierte und bis auf die Zähne bewaffnete Männer türmten sich vor mir auf. Ich zählte rund fünfzehn Polizisten, die sich um unser Fahrzeug versammelt hatten. Der, der mir am Nächsten stand, übernahm das Wort: «Passaporte.» Das war keine Frage, sondern ein Befehl. Sein Gesicht verzog keine Miene, er starrte eisern vor sich hin. Ich drehte mich langsam um und bemühte mich, keine ruckartigen Bewegungen zu machen. Wer wusste schon, worauf die schiessen würden. Vorsichtig öffnete ich meinen Rucksack, nahm meinen roten Pass heraus und übergab ihn dem Typen gleich neben mir. Währenddessen hatten seine Kumpels den Kofferraum geöffnet und meinen riesigen, schwarz-blauen Rucksack herausgehievt. Er wurde geöffnet und von oben bis unten durchsucht. Zuerst musste ich schmunzeln: ich war wohl die allerletzte Person auf Erden, bei der man Drogen finden würde. Mein Gewissen war rein, bei mir würde man mit Sicherheit nichts finden. Aber dann plötzlich stockte mir der Atem. Was, wenn unser Fahrer irgendwo Koks versteckt hatte? Schliesslich waren wir hier in Kolumbien, hier gabs wahrscheinlich Koks bis zum abwinken…! Er könnte seine Fracht versteckt haben… Zum Beispiel im Kofferraum seines Autos? Was für eine geniale Tarnung, ahnungslose, junge, weisse Touristinnen durch die Gegend zu chauffieren! Ich war beeindruckt. Und es dann uns anhängen! Den Polizisten würde es bestimmt Vergnügen bereiten, uns blöde Tourigänse zu verhaften, garantiert lieber, als ihren eigenen Landsmann. Und wir beide, ich und Helen, konnten zu schlecht Spanisch, als dass wir uns da hätten wehren können. Ich sah es schon vor mir, wie wir in Handschellen abgeführt würden, spürte die Panik hochkommen, bevor ich durch die Stimme des Polizisten neben mir in die Realität zurückgeholt wurde. Er blätterte immer noch in meinem Pass, und wollte, ohne aufzublicken, von mir wissen: «Donde eres?» «Suiza», erklärte ich. Eigentlich bedurfte es ja keiner Erklärung, konnte er denn nicht selbst lesen, woher mein Pass stammte? Er blickte verwundert auf: «Suiza??» Ich nickte. Mein Rucksack war mittlerweile als drogenlos befunden und zurück in den Kofferraum verfrachtet worden. Seine Gesichtszüge wurden nun weicher. Er blickte die anderen an und zeigte auf meinen Pass: «Es de Suiza!» Die Atmosphäre um mich herum machte eine Kehrtwendung von 180 Grad. Er lächelte (lächelte?) und gab mir die Hand: «Bienvenida in Colombia!», meinte er und schüttelte sie kräftig. Ich versuchte freundlich zu klingen: «Gracias.» Aber er liess meine Hand nicht mehr los. Mittlerweile strahlte er übers ganze Gesicht und seine Kumpanen hatten ihr Mobiltelefon gezückt, um ein Foto von uns zu machen. Es klickte und der nächste stellte sich neben mich, um mir die Hand zu schütteln und fürs Foto zu posieren. Ich blieb wie angefroren stehen und starrte wie von Dannen auf die geladenen Maschinengewehre, die zwischen uns baumelten, und verstand die Welt nicht mehr.
Helen erging es gleich. Als ich meinen Blick wandte, erkannte ich, dass auch sie einem Militäroffizier die Hand schüttelte. Er musste ein hohes Tier sein, er trug keinen Helm sondern eine Mütze und Brille, und die anderen blickten zu ihm hoch. Er bedankte sich bei ihr und hiess sie immer wieder in Kolumbien Willkommen. Das ganze Spektakel dauerte ungefähr zehn Minuten, bis unser Fahrer eingriff und meinte, dass wir erwartet wurden. Man hielt mir die Tür auf und ich stieg zurück in unseren hoffnungslosen Fall von einem Auto. Bevor die Tür geschlossen wurde, kam nochmals ein Polizist auf meine Seite und gab mir die Hand. Dann schloss er sachte die Tür und winkte dem Auto hinterher, bis eine Staubwolke seine Umrisse verschluckte.
Wir kamen nicht weit. Kaum hatten Helen und ich unsere «Was-war-das-denn?»-Blicke ausgetauscht und einmal tief durchgeatmet, kamen wir erneut zum Stillstand. Vor uns wurde die Nacht wie eine Disco von tanzendem Blau und Rotlicht erhellt. «Was geht da vorne vor sich?», wollten wir von unserem Fahrer wissen. Wir konnten zwei weitere Militärjeeps erkennen und einen grossen, weissen Lieferwagen in der Ferne, dessen Beifahrertür offen stand. Die Polizei, die, wie ich jetzt langsam erkannte, aus Militär bestand, hatte sich um den Wagen und auf der Strasse versammelt und unterhielt sich. Andere hasteten mit gezückten Waffen ins Gebüsch. Als würden sie jemanden suchen. Oder gar verfolgen? Hier waren es nochmal deutlich mehr Polizisten, es mussten um die dreissig Männer sein. Nicht zu reden von all denen, die sich gerade im Gebüsch und Wald versteckten. Ich drehte mich um und erkannte, dass uns die anderen drei Fahrzeuge von vorhin gefolgt, und uns wieder ins Sandwich geparkt hatten. Also schon wieder: kein Vorankommen mehr. Langsam war ich genervt. Ich wollte, dass dieser endlos lange Tag endlich vorbei war, ich ins Bett fallen und die Augen schliessen konnte. Doch ein nahes Ende schien nicht in Sicht. Diese Leute schienen offenkundig jemanden zu suchen. Und solange man denjenigen nicht gefunden hatte, würde man wohl nicht Platz machen. Erneut veränderte sich die Stimmung um uns herum: plötzlich lag Anspannung in der Luft. Es knisterte förmlich. Die Männer hoben ihre Maschinengewehre an, bereit zum Abschuss, und fingen an, um den Lieferwagen herum zu schleichen. «Was geht da vor?», wollte Helen wissen und lehnte sich nach vorne zu unserem Fahrer. «Drogen», murmelte unser Fahrer. «Ist es gefährlich?», fragte sie ihn, und ich vernahm einen leisen, hysterischen Unterton in ihrer Stimme. Ich konnte sie verstehen. Ganz langsam spürte auch ich, wie Angst in mir hochkroch. Er erklärte uns, dass man diesen verlassenen Lieferwagen gefunden hätte und nun auf der Suche nach dem Fahrer sei, dass man hier ein Drogengeschäft vermute. Aber er verneinte, es sei nicht gefährlich. Es klang nicht überzeugt. Ich musste an Drogenkartelle denken und daran, wie skrupellos die waren. An erbarmungslose, blutige Gefechte, die sich Polizei und Drogenkuriere lieferten. Und wir waren genau dazwischen, zwischen Drogenkurier und Polizei. Würde es zum Schusswechsel kommen: wir befänden uns genau in der Schusslinie…
Angespannt warteten wir, beobachteten aus dem vermeintlich sicheren Innern unseres Krüppelautos das Treiben ausserhalb des Wagens. Es war Hektik eingetreten, die Waffen im Anschlag. Immer wieder verlor ich mich im Kopfkino, sah Schiessereien aus Filmen vor mir und malte mir aus, wie wir zwischen den feindlichen Linien durchlöchert wurden. Unfähig, uns zu wehren oder zu flüchten. Wir steckten in der Falle. Während ich mir äusserlich nichts anmerken liess und stumm versuchte, ruhig zu bleiben, wurde Helen immer nervöser. Sie fragte unseren Fahrer immer wieder, ob es nicht zu gefährlich sei, und ich konnte ihre Panik spüren. Es machte mich unruhig. Unser Fahrer versuchte locker zu wirken, doch ich konnte auch in seinen Augen Furcht flackern sehen. Ich blieb stumm und beobachtete. Versuchte, die Gedanken aus meinem Kopf zu vertreiben. Das Warten schien endlos lange zu dauern, aber in Wirklichkeit mussten es wohl um die zehn Minuten gewesen sein, bis ein Offizier zu uns ans Auto trat. Unser Fahrer unterhielt sich mit ihm, und aus einigen Fetzen heraus verstand ich, dass er ihn fragte, ob wir passieren konnten. Zu meinem Erstaunen schaltete er einige Minuten später tatsächlich den Motor ein, und man winkte uns durch. Als wir am Lieferwagen vorbei kamen, erkannte ich, dass da ein Mann stand, umringt von Polizisten. Man hatte also den Fahrer gefunden. Ein einfacher Bauer, wie es auf den ersten Blick schien. Unsere Blicke begegneten sich, und seine Augen folgten unserem Pfad, bis ich ihn aus den Augen verlor.
Doch unsere Reise war noch nicht beendet. Weitere Schlaglöcher, weiteres Ruckeln, bis wir in Rincon ankamen. Wir fuhren durch das Dorf hindurch, sahen Menschen, die auf dem sandigen Weg liefen, der uns als Strasse diente. Bis die Strasse endete. Es war dunkel, und wir hielten vor einem Gebäude, welches mit diversen Hostelnamen bemalt worden war. Der Name unseres Hostels fehlte. Hier konnten wir nicht richtig sein! Wir versuchten unserem Fahrer zu sagen, er solle uns zu unserem Hostel bringen, doch dann traten zwei junge Männer zu uns und meinten, man hätte sie geschickt um uns abzuholen. Sie würden uns zu unserem Hostel bringen. Sie nahmen unser Gepäck und bedeuteten uns, ihnen zu folgen. Wir waren zu erschöpft von der langen Reise, um zu protestieren. Und mussten wohl einfach darauf vertrauen, dass die beiden die Wahrheit sagten. Also folgten wir ihnen, durch das Dorf hindurch. Auch hier waren die Strassen aus Sand, aber sie waren für Fussgänger oder Motorräder gemacht. Keine Autos, dazu waren die Strassen zu schmal. Sie erklärten uns, dass wir noch ungefähr zehn Minuten laufen mussten bis zum Hostel. Meine Laune sank. Ich war bloss froh, dass ich meine siebzehn Kilo nicht tragen musste. Der Weg führte uns über eine provisorische, kleine Holzbrücke. Das verlieh dem Ganzen Trip etwas abenteuerliches und charmantes. Wir liefen weiter entlang Häuser, alle in verschiedenen Farbtönen bemalt. Möglichst farbig versteht sich, schliesslich befanden wir uns hier in der Karibik. Von pink bis knallgrün oder violett und blau gab es alle Varianten. Wir liefen, und plötzlich kam eine Unterkunft mit Fackeln im Sand zum Vorschein. Sie steuerten direkt auf uns zu. Die Bar war offen und gen Meer gerichtet, und es sassen noch einige Leute an der Bar. Dania kam uns sofort entgegen und entpuppte sich als eine junge, zierliche, braunhaarige Halbkolumbianerin. Sie sprach perfekt Englisch und begrüsste uns überschwänglich. Wir bedankten uns für die gesamte Organisation, und waren einfach froh, endlich angekommen zu sein. Ihr Ehemann brachte uns sofort in unser Zimmer. Es war gross und geräumig, ein Dorm zwar, den wir aber nur mit zwei anderen (ein deutsches Pärchen) teilen mussten. Ich war dieses Mal dran, das obere Bett zu beziehen, während Helen sich unterhalb einrichtete. Es war eine Eco-Lodge und wir wurden darauf hingewiesen, dass Wasser im Dorf knapp war, weil es kaum regnete. Man besass zwar einen Wasserspeicher für die Lodge, trotzdem wurde man gebeten, gewissenhaft mit dem Wasser umzugehen und so die Duschen kurz zu halten und nicht unnötig Wasser zu verbrauchen. Des Weiteren konnte man seine eigene Flasche gratis jederzeit mit gefiltertem Wasser nachfüllen. Das Hostel war aus Bambus aus dem Dorf aufgebaut und Palmblätter als Dach verwendet. So konnte man umweltfreundlich bauen und es jederzeit einfach erneuern und ausbessern. Wir waren zu müde, um noch gross zu erkunden, und so duschten wir beide kurz und fielen danach erschöpft in unsere Betten, während wir zum Klang der Wellen draussen langsam eindösten.









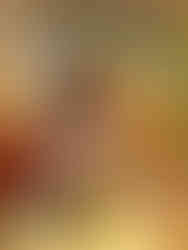





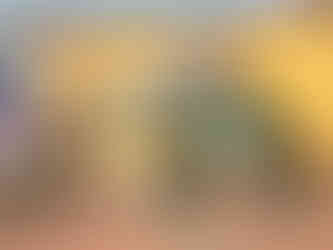








Comments